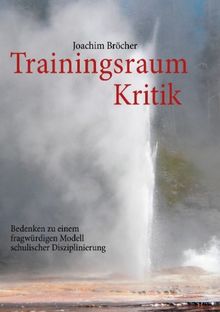
Seit 2003 hat sich das "Trainingsraum"-Programm (TRP), ein Time-out Modell, das auf dem amerikanischen "Responsible Thinking Process" (RTP) basiert, an deutschen Schulen etabliert, als Antwort auf die zunehmenden Auffälligkeiten im Lern- und Sozialverhalten von Schülerinnen und Schülern. Im Zuge der Umsetzung der UN-Konvention empfehlen Schulverwaltungen und Wissenschaftler die Implementierung des TR, um insbesondere den Erfolg der inklusiven Beschulung bei Förderbedarf in der emotionalen und sozialen Entwicklung zu sichern. Formale Inklusion und schulinterne, temporäre, Exklusion werden somit verschränkt. Das Ergebnis der vorliegenden Programm-Evaluation ist, dass bisher kein überzeugender empirischer Nachweis für die Effektivität des TRP vorliegt. Die Daten sprechen eher dafür, dass sich durch die Anwendung des TRP eine negative Auswirkung auf das Lehr-Lern-Geschehen in den Klassen und auf die Kultur einer Schule insgesamt ergibt. Während das TRP das Ziel verfolgt, die Disziplin im Klassenzimmer zu erhöhen und die Lehrer zu entlasten, verhindert das Programm zugleich die Entwicklung einer stärkenorientierten und partizipativen Lernkultur. Diese wäre aber gerade für eine erfolgreiche Inklusion von Schülerinnen und Schülern mit Förderbedarf in der emotionalen und sozialen Entwicklung fundamental wichtig. Auch Menschenbild und Bildungsideal des TRP werfen erhebliche Bedenken auf. Abschließend werden alternative Möglichkeiten aufgezeigt, wie die inklusive Beschulung von Schülerinnen und Schülern mit Förderbedarf in der emotionalen und sozialen Entwicklung adäquater unterstützt werden kann.