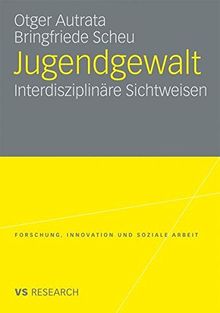
Jugendgewalt ist zu einem bedeutsamen Bestandteil der gesellschaftlichen und gesellschaftspolitischen Debatte geworden. Im Blickpunkt der Diskussionen ist häufig der Diskurs um die Entwicklung von Häufigkeit und Intensität von - gendgewalt im großen Maßstab. Zu berücksichtigen ist aber auch, dass jedes einzelne Vorkommnis von Jugendgewalt für ihre Opfer wie auch häufig für die TäterInnen, die diese gewalttätige Handlungsform begehen und später mit - strafung rechnen müssen, leidvolle Erfahrungen stiftet. Die gesellschaftliche Betroffenheit durch Jugendgewalt wie auch daraus - sultierende Bedrohtheitsgefühle werden oft als Auftrag an die Soziale Arbeit und andere Professionen weitergegeben: Jugendgewalt soll verhindert oder - mindest eingedämmt werden. Das schafft eine komplexe Anforderungsstruktur und wirft auch die Frage auf, ob die Soziale Arbeit und andere Professionen - ne solche Aufgabe überhaupt bewältigen können. Es gibt Arbeitsansätze in der Sozialen Arbeit, wie mit dem Problem der Jugendgewalt umzugehen ist; sk- tisch zu reflektieren ist, ob solche durch Ressourcen und das methodische V- ständnis begrenzten Arbeitsformen zum Erfolg führen können.